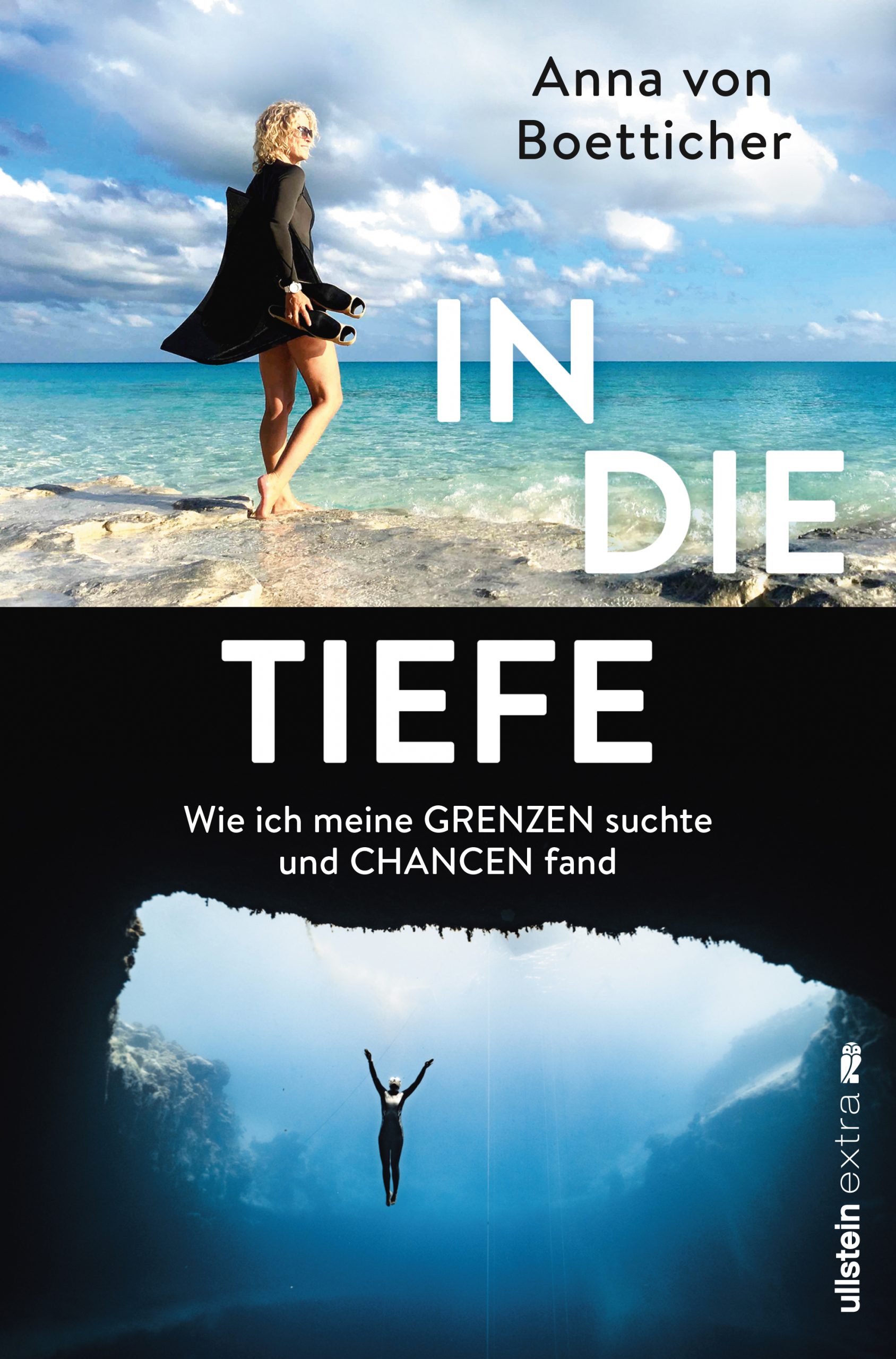Susanne Krauss, 57
Fotografin
Susanne Krauss, 57

„Ich glaube, es macht großen Sinn, die Leute zu ermutigen, einfach so zu sein wie sie sind“


Fotos: Susanne Krauss
Ich beschäftige mich ja schon lange mit Menschen in allen Lebenslagen. Und irgendwann fiel mir auf, dass Frauen mit zunehmendem Alter, ich sage mal, mit dem Eintritt ins Rentenalter, in der Wahrnehmung der Gesellschaft langsam verschwinden. 2017 entstand dann ein Projekt, bei dem ich Frauen in Superheldinnen-Kostümen aus bereits vorhandenen Fotos in Photoshop zusammenstellte und als Collage präsentierte. Diese Porträts kamen bei älteren Damen so gut an, dass ich mir dachte, da könne man mehr daraus machen. Ich erkundigte mich im Bekanntenkreis bei meiner Mutter und auch bei anderen älteren Frauen, ob sie vielleicht Interesse hätten, sich von mir in Superheldinnenkostümen porträtieren zu lassen. Aber leider konnte ich damals niemanden für dieses Projekt gewinnen. Und dann habe ich das erst einmal so ein bisschen ad acta gelegt.
Wieso wollten sich die Frauen denn nicht fotografieren lassen?
Die einen fanden sich nicht schön genug, andere fühlten sich zu alt, wieder andere sagten: „Ich würde mich seltsam fühlen, wenn ich mich verkleide.“
Und dann?
Probierte ich zunächst mit der KI rum und kombinierte das Ganze nochmals mit Photoshop. Aus Spaß habe ich die Bilder dann später auf meinen Instagram-Account gestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich vielleicht 2000 Follower, über Nacht ging der Account dann aber durch die Decke. Ich konnte das erst gar nicht glauben und weiß noch, wie ich zu meinen Töchtern sagte: „Ich glaube, jemand hat meinen Account gehackt.“ Die vielen positiven Reaktionen ermutigten mich, das Ganze dann noch einmal als richtiges Projekt zu etablieren.
Ich bekam damals so zwischen 300 und 400 Nachrichten pro Tag.“
Wie hast du die Frauen gefunden? Wie bist du vorgegangen?
Zunächst einmal ganz blauäugig. Ich startete auf Instagram einen Aufruf und schrieb sinngemäß: „Das hier ist jetzt KI. Wer aber Lust hat, dass wir das im realen Leben umsetzen, der möge sich bitte bei mir melden.“ Ich hatte dabei aber nicht bedacht, dass mir die Frauen ja wirklich international folgen. Da kamen aus Südamerika, aus Nordamerika, aus Italien und sonst woher Anfragen. Aber das konnte ich weder finanziell noch zeitlich leisten. Und so musste ich noch einmal umstrukturieren – und habe das Vorhaben in einen kleinen Contest umgewandelt, bei dem Frauen, egal von woher, quasi die Collage mit ihrem eigenen Foto gewinnen konnten.
Wie waren die Reaktionen?
Ich bekam zum Teil ganze Lebensgeschichten geschickt und auch Dankesbriefe, in denen die Frauen schrieben, die Bilder würden Hoffnung machen und „Ich habe jetzt richtig Lust darauf, alt zu werden.“ Ich bekam damals so zwischen 300 und 400 Nachrichten pro Tag; tatsächlich ging es Tag und Nacht nur noch um dieses eine Thema. Nach diesem kleinen Wettbewerb habe ich dann gesagt, ich würde das Ganze nun gern als richtiges Fotoshooting machen und startete mit der Journalistin Ulla Wohlgeschaffen nochmals einen Aufruf: „Wenn ihr in der Nähe von München wohnt, und Lust auf das Projekt habt, meldet euch bitte.“
Mir war wichtig, dass die Frauen nicht operiert sind, also Schönheitsoperationen hatten.
Nach welchen Kriterien hast du die Frauen ausgesucht?
Die zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten mussten passen, und natürlich auch die Offenheit. Äußerlichkeiten spielten überhaupt keine Rolle, weil bei dem Projekt sollte ja deutlich werden, dass es ganz egal ist, wie schön, wie groß oder klein oder dick oder dünn jemand ist. Wichtig war mir allerdings, dass die Frauen nicht operiert sind, also Schönheitsoperationen hatten oder dass die Frauen nicht schon selbst irgendwie als Influencer arbeiten, die also außerhalb dessen sind, was eine normale Frau in dem Alter lebt. Zum einen, weil ich ein realistisches Spektrum haben wollte und zum anderen wollte ich nicht die noch hypen, die sowieso schon für etwas bewundert werden.
Bei dem Projekt sollte deutlich werden, dass es ganz egal ist, wie schön, wie groß oder klein oder dick oder dünn jemand ist.
Es war beispielsweise eine dabei, die erzählte, wie sie es als Kind ganz oft erlebt hatte, dass sie übergriffig fotografiert worden ist. Nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach, dass man ihr immer Anweisungen erteilt hatte, wie sie zu sitzen, zu schauen oder zu lachen hat. Das fand sie so schrecklich, dass sie beschloss, sich nie mehr fotografieren zu lassen. Von ihr gibt es tatsächlich keine Bilder im Erwachsenenalter. Sie sagte, „ich möchte es jetzt doch noch einmal versuchen, bevor ich ganz alt bin.“
Wie lief das Shooting ab?
Mir war wichtig, dass die Frauen sich alles wünschen durften. Also von den Kostümen bis zum Setting, sie waren keinerlei Zwang unterworfen, auch nicht, sich in irgendeine Pose zu werfen oder einen Gesichtsausdruck anzunehmen, den sie nicht wollen. Ich glaube, es macht großen Sinn, die Leute zu ermutigen, einfach so zu sein, wie sie sind. Wir haben immer viel geredet und versucht herauszufinden, was die Schwerpunkte sind. Bei den Kostümen konnten sie zwischen einer großen Auswahl entscheiden, auch teilweise virtuell, verbunden mit der Frage: Möchtest du lieber eine edle Supergranny sein oder eine Wilde?
Und für was haben sie sich entschieden?
Die Frau etwa, von der ich eben gesprochen hatte, die wollte beispielsweise bunte Haare, sie wollte edel aussehen. Eine andere sagte, sie habe es satt, immer freundlich zu lächeln. Sie möchte ein Bild von sich, wo sie kämpferisch und fast schon aggressiv rüberkommt, weil sie das Gefühl hat, unsichtbar zu sein, nicht mehr wahrgenommen zu werden. Wenn sie etwa über die Straße geht, dann halten die Autos nicht. Es gibt wirklich Untersuchungen darüber, dass zum Beispiel Frauen und auch Männer mit grauen Haaren tatsächlich auf der Straße nicht mehr wahrgenommen werden. Aber nicht, weil man sie bewusst übersieht, sondern weil grau eine so unauffällige Farbe ist, dass man damit praktisch aus dem Bewusstsein rutscht.
Sie sagt, sie fühle sich richtig toll. Dass sie im Alter noch den Mut hatte, ihre Träume zu verwirklichen
Im Ausstellungskatalog findet sich zu den Fotos der Frauen auch jeweils ein kurzer Abriss ihres Lebens.
Ja, meine meine Mitstreiterin Ulla Wohlgeschaffen hatte die Frauen nochmal extra nach den Shootings interviewt. Und zum Teil wurden dann Schicksale öffentlich, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte.
Nämlich?
Eine zum Beispiel hatte ganz klassisch mit ihrem Mann in einem Reihenhäuschen gelebt. Der Mann war beruflich immer viel unterwegs und sie hatte in der Zwischenzeit den Haushalt und die Kinder besorgt. Als ihr Mann später in Rente ging, wollte sie auch endlich einmal verreisen, ihr Mann aber meinte: „Nee, ich war schon so viel unterwegs, das ist mir zu viel.“ Sie suchte sich dann einen Nebenjob und sparte das Geld. Sie hat dann wirklich noch große Reisen gemacht. Im alten Kinderzimmer hängen bis heute ihre Reisefotos. Immer, wenn ihr danach ist, setzt sie sich in dieses Zimmer und schaut sich ihre Bilder an. Sie sagt, sie fühle sich richtig toll. Dass sie im Alter noch den Mut hatte, ihre Träume zu verwirklichen. Und das finde ich großartig. Davon gibt es viel solcher Geschichten.
Warum ausschließlich Frauen über 70?
Tatsächlich hatte ich Anfragen von Frauen ab den Wechseljahren. Aber für das Projekt war diese Altersgruppe noch nicht passend. Wenn diese Frauen verkleidet sind, sieht man den Unterschied nicht, sie sehen noch zu jung aus. Und ich wollte bewusst das visuell so hinbekommen, dass das auf den ersten Blick passt.
Alle Grannies, die mir begegnet sind, die haben mir sehr viel Mut gemacht.
Wäre solch ein Projekt auch mit Männern denkbar?
Speziell bei diesem Projekt schloss sich das aus, weil das ja eine Persiflage auf die männlichen Superhelden ist. Aber es stimmt. Diese Generation der so ein bisschen vergessenen Männer hätte ich auch sehr gerne einmal in einem Projekt, weil – wie es oft im Leben ist – die Sensiblen, Zartbesaiteten geraten schneller aus der Gesellschaft als die, die so mit Ellenbogen vorne stehen. Und ich glaube, da gibt es wirklich wunderbare Männer, die eine Plattform kriegen sollten, wo man sie auch noch mal sozusagen ins Scheinwerferlicht rückt. Niemand von uns will unsichtbar sein. Allen Menschen geht es ja von Geburt an so, dass sie Wertschätzung erfahren wollen oder ein bisschen Anerkennung. Gerade in der heutigen Gesellschaft, wo sich alles so schnell dreht und eben auf Portalen wie Instagram, auf denen Leute sozusagen laut um Aufmerksamkeit schreien, gehen weniger extrovertierte Menschen unter.
Was ist Bleibendes für dich aus der Arbeit mit den Grannies geblieben?
Alle Grannies, die mir begegnet sind, die haben mir sehr viel Mut gemacht. Da war zum Beispiel eine dabei, sie ist heute 82 und arbeitet immer noch als Coachin und Beraterin. Und wenn ich sie erlebe oder treffe, dann weiß ich, wie ich alt werden möchte. Ich finde ja generell, dass es total Sinn macht, sich viel mit Menschen, die älter sind als man selbst, zu beschäftigen. Weil sie in vielfacher Hinsicht ein Vorbild sein können. Die fürchten andere Dinge, weil sie schon viel erlebt haben – oder schätzen deswegen auch andere Dinge, weil sie ihre Erfahrungen gemacht haben.
Wie möchtest du alt werden?
Natürlich wie alle: Möglichst gesund. Möglichst frei. In einer Demokratie lebend. Und: Glückliche Enkelkinder erleben zu dürfen. Ich habe zwar bisher nur eins. Aber ich muss sagen, das flasht mich total, das habe ich nicht für möglich gehalten. Bei Enkelkindern, ich habe das neulich mal gelesen, bekommst du praktisch das Glück, das du mit deinen eigenen Kindern erleben durftest, noch mal in Leichtigkeit zurück. Zugleich aber ist ein Leben natürlich von Anfang bis Ende nicht nur fröhlich, da kommen immer auch blöde Phasen und ich denke, das man in den guten Zeiten dafür Kraft schöpft. Einer meiner Lieblingssätze lautet: Alles geht vorüber. Das Gute. Aber eben auch das Schlechte.
Mehr Informationen:
https://www.susanne-krauss.de
Es gibt wirklich Untersuchungen darüber, dass zum Beispiel Frauen und auch Männer mit grauen Haaren tatsächlich auf der Straße nicht mehr wahrgenommen werden.